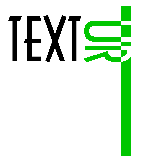Karl K.
Zwischenlager
Wieder liefen wir durch Humpolec und niemand kümmerte sich um uns. Sie trugen mich in ein im Zentrum der Stadt gelegenes, größeres Gebäude. Im Erdgeschoss war ein provisorisches Krankenzimmer mit sechs Etagenbetten eingerichtet. Es gab sogar ein Bad und einen Toilettenraum. Bis auf eines waren die Betten belegt mit verletzten deutschen Soldaten, die hier offenbar schon längere Zeit versorgt wurden. Keiner von ihnen war transportfähig.
Für mich bedeutete es, dass ich das erste Mal seit vielen Wochen wieder in einem richtigen Bett lag. Es gab keine explodierenden Granaten um mich herum, also keine unmittelbare Todesgefahr. Innerhalb kürzester Zeit fiel ich in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Zu den Mahlzeiten musste ich am Anfang jedes Mal von meinen Leidensgenossen geweckt werden.
Wir waren nicht vergessen. Immer mal wieder schauten die Sanitäter und auch kleine Ärzteteams, bestehend aus deutschen und russischen Ärzten, bei uns vorbei und sahen sich unsere Wunden aus der Nähe an. Für sie war ich kein besonders interessantes Objekt, denn ich hatte ja neben meinem dicken Knie „nur“ einen kleinen Einschuss vorzuweisen – vermutlich eben nur einen Lungensteckschuss. Keiner wusste was Genaues. Trotzdem war ich in dieser Zeit noch so geschwächt, dass ich nicht auf eigenen Beinen stehen konnte.
(…)
Das Einzige, was mich interessierte war: Wann bin ich transportfähig und wann geht ein Transport in die Heimat? „Heimat“, das war für mich erst einmal Deutschland, alles Weitere würde man sehen.
Die deutschen Sanitäter, die uns täglich zu unterschiedlichsten Zeiten am Krankenlager besuchten, brachten uns Kleinigkeiten zu essen und zu trinken und versorgten unsere Wunden so gut sie konnten. Von diesen Sanitätern kann ich – wie für die Rot-Kreuz-Schwestern – nur mit größter Hochachtung und Dankbarkeit berichten. Als alle Organisationen und Befehlsstrukturen in sich zusammenbrachen, erfüllten diese Männer und Frauen in vorbildlicher Weise weiter ihre Aufgaben im Sinne der Menschlichkeit. Das ist etwas, was ich nicht von allen Ärzten sagen kann.
Täglich stellten wir uns Fragen wie: Wann geht endlich ein Transport heim ins Reich? Und wie geht es wohl unseren Angehörigen?
Hoffen auf Heimfahrt
Nach neun Tagen erfuhren wir von unseren Sanitätern, dass am nächsten Tag, das war der 20. Mai 1945, ein Sammeltransport Richtung Heimat gehen würde. Auch ich wurde an diesem 20. Mai auf einer Trage zum Bahnhof gebracht, es war gar nicht weit. Dort angekommen, wartete ein langer Zug, in dem sich schon viele deutsche Soldaten befanden. Zu unserer großen Verwunderung wurde dieser Zug von zahlreichen russischen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett bewacht.
Die Sanis schoben mich in einen Güterwagen. Danach forderten die russischen Wachposten auch sie auf, ebenfalls einzusteigen. In dem Moment kamen zwei tschechische Nachkriegspartisanen mit einer alten Frau auf einer Trage angerannt. Sie wollten die Frau schnell noch in den Wagen schieben. Das allerdings verhinderten die russischen Posten und sagten, dass in diesem Zug ausschließlich deutsche Soldaten transportiert würden. Die Tschechen wichen zurück und blieben dann stehen. Kurz danach ertönte das Signal zur Abfahrt.
Die Posten sprangen behände auf die Waggons und der Zug setzte sich in Bewegung. Das war der Moment, in dem die beiden Tschechen die Trage schnappten, auf der die Kranke lag. Mit kräftigem Schwung schleuderten sie die Frau in unseren Waggon. Ihr Körper rollte mehrere Meter über den harten Boden, dann blieb sie wimmernd und mit weit aufgerissenen Augen neben mir liegen. Höhnisch lachend winkten uns die beiden Tschechen zu und verschwanden. Hilfsbereit kümmerten sich die beiden Sanitäter um das Mütterchen. Mit schwacher Stimme gab sie sich als Deutsche zu erkennen.
Der Zug fuhr im Schneckentempo weiter, häufig blieb er ganz stehen. Die russische Bewachung haben wir übrigens mehr als Schutz vor den Tschechen, denn als Bedrohung empfunden. Und das, obwohl der Zug nicht nach Westen, sondern Richtung Osten fuhr.
Zwar gab es eine Feldküche im Zug, doch die hatte anscheinend keine Lebensmittel dabei. Jedenfalls verließen die russischen Soldaten bei jedem Stopp den Zug, um von den links und rechts der Strecke liegenden Bauernhöfen etwas zu besorgen. Ab und zu schossen sie auch ein Hühnchen für unsere Küche. Einmal sah ich, wie sie ein dickes Schwein mitnehmen wollten, aber da hatte sich das halbe Dorf laut protestierend versammelt. Daraufhin haben sie das Tier laufen lassen.
Vorläufiges Ziel: Deutsch-Brod
In Deutsch-Brod mussten alle den Zug verlassen. Man brachte uns in ein großes Sammellager. Ich kam mit einigen anderen in einer halbrunden Wellblech-Baracke unter. Dort stellte man mich mit meiner Trage einfach ab. Hier blieb ich circa zwei bis drei Tage liegen. Wieder wurde ich von meinen beiden Sanis mit dem Notwendigsten versorgt.
In diesem Lager machte ich erste Erfahrungen mit der russischen Propaganda und den deutschen Antifaschisten. Diese Antifaschisten waren Deutsche wie wir, die sich aber schon länger in russischer Kriegsgefangenschafft befanden. Jetzt fungierten sie als Sprachrohr für die russische Propaganda, ebenso als Spitzel und Hilfspolizisten. Sie stellten sich als äußert brutal gegen die eigenen Kameraden sowie unterwürfig und eifrig gegen die Russen heraus. Es waren beileibe keine Idealisten, die da plötzlich für hohe menschliche Werte eintraten. Es waren fast alles – ich sage bewusst „fast“ – charakterlose Lumpen, die sich bei den Russen beliebt machen wollten, indem sie die eigenen Kameraden besonders schäbig behandelten.
Gleich am ersten Tag gerieten diese Typen mit meinen Kameraden in Streit. Es kam zu einer Prügelei. Daraufhin organisierten die Antifaschisten mit Hilfe der russischen Wachposten eine Strafaktion: Am nächsten Morgen mussten alle deutschen Kriegsgefangenen aus dem Bereich, in dem die Streitigkeiten stattgefunden hatten zum Zählappell antreten. Es sollten die vortreten, die sich mit den Antifaschisten geprügelt hatten. Wie zu erwarten, trat niemand hervor, es wurde auch keiner verraten.
Aus meiner Baracke heraus konnte ich die Lagerstraße einsehen. Uns gegenüber stand eine größere Baracke, die vermutlich als Speiseraum diente. Durch die großen Fenster sah ich, wie sich circa 20 Antifaschisten mit Knüppeln in den Händen formierten. Dieses Spalier mussten alle angetretenen Soldaten einzeln durchlaufen und heftige Prügel einstecken. Ich kann diese Szene nicht vergessen, sie erfüllt mich noch heute mit Wut und Scham.
Am dritten Tag in Deutsch-Brod wurde ich in ein großes Lazarett gebracht. Wie ich später erfuhr, war dies ein ehemaliges SS-Lazarett. Ich lag auf meiner Trage nur mit Unterwäsche bekleidet und einer Decke darüber. Meine Uniform und meine Schuhe besaß ich nicht mehr. Allerdings hatte man uns unsere Soldbücher gelassen. Diese Soldbücher waren sowohl für uns als auch für die Russen sehr wichtig. Für uns, um Angehörige von toten Kameraden zu benachrichtigen, für die Russen, u. a. um Kriegsverbrechen zu erkennen. Enthielten sie doch alle persönlichen Daten, Einheiten und Standorte.
Hier im Lazarett wurde ich in ein kleines, freundliches Zimmer getragen, in dem nur drei Einzelbetten standen. Ich war natürlich angenehm überrascht. Nur eines der Betten war belegt. Man legte mich in das zweite Bett, danach verließen die Sanitäter mich, nicht ohne mir noch gute Besserung zu wünschen.
Mein neuer Bettnachbar schaute mich eine Weile prüfend an, dann fragte er mich mit zitternder Stimme: „Haben sie dich auch schon aufgegeben?“ „Wie kommst du darauf?“, war meine Gegenfrage. Er zögerte einen Moment mit der Antwort. „Ja, weil du hier im Sterbezimmer bist.“ Mir verschlug es erst einmal die Sprache, dann fuhr er fort. „Den Kamerad, der vor dir in dem Bett lag, hat man erst vor wenigen Stunden tot rausgetragen. Schuhe und Uniform liegen noch unterm Bett. Der Kamerad aus dem dritten Bett wird gerade operiert. Ob der durchkommt, ist zweifelhaft.“
Nach einiger Zeit brachten zwei Sanitäter und ein Arzt den frisch Operierten zurück. Er lag noch in Narkose und ist nicht wieder aufgewacht.
Unerwartetes Wiedersehen
Zu essen und zu trinken bekamen wir nur ganz unregelmäßig. Nach unserer Notdurft fragte niemand. So machte ich mich irgendwann auf, eine Toilette zu suchen. Dazu folgte ich dem Hinweis mit der Aufschrift „Waschraum“. Unterwegs begegnete mir kein Mensch, es war irgendwie unheimlich. Als ich endlich den Vorraum zum Waschraum erreichte, sah ich, dass dort auf dem Fußboden circa zwanzig Bahren standen, die jeweils mit einem weißen Betttuch abgedeckt waren. An den gelb-weißen Füßen, die unten aus den Tüchern herausschauten, wurde mir bewusst, dass hier Tote zum Abtransport bereitgestellt waren. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl als ich mit langen Schritten über die Körper stieg, um die Toilette zu erreichen. Zum Glück brauchte ich nicht in ihre Gesichter zu schauen.
Im Waschraum fand ich Waschbecken und Spiegel vor. Es war das erste Mal seit Tagen, dass ich mein Gesicht sah. Ich fragte mich, ob ich es wirklich bin: abgemagert, unrasiert und verlaust. Als ich noch mit mir Zwiesprache hielt, hörte ich plötzlich Schritte. Ein ebenfalls verwundeter Kamerad stellte sich neben mich. Er bat mich, aus einer Tube etwas Zahnpasta auf seine Zahnbürste zu drücken. Ich sah, dass seine linke Hand fehlte. Als wir uns dann direkt anschauten, erkannten wir uns wieder. Es war ein guter, sympathischer Kamerad aus meiner Aufsicht in Breslau-Schöngarten. Wir fielen uns in die Arme und jeder erzählte dem anderen seine Geschichte. So erfuhr ich von seinen unglaublichen Erlebnissen.
Er war mit einem Teil unserer Einheit bis nach Deutsch-Brod gekommen. Hier gerieten sie in russische Kriegsgefangenschaft. Die Russen hatten auf einem Feldflugplatz der deutschen Luftwaffe mit großer A/B-Schule ein riesiges Sammellager errichtet. In seiner Kompanie befand sich auch unser Fähnrich, der damals zusammen mit „Pöppchen“ in einer Bücker 181 von Dievenow nach Fürstenfeldbruck unterwegs gewesen war, einige pikante Situationen erlebte und wegen unmoralischen Verhaltens zum Flieger degradiert wurde. Neben anderen Maschinen, die wir im Rahmen unserer Ausbildung geflogen hatten, stand dort auch eben dieser Typ Flugzeug auf dem Flugfeld.
Auf dem Platz waren übrigens auch einige französische Techniker unterwegs, die im Dienste der deutschen Luftwaffe gearbeitet hatten. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie von den Russen nicht gleich nach Hause geschickt worden waren.
Diese beiden Kameraden – er und der ehemalige Fähnrich – hatten nun die glorreiche Idee, sich diese Bücker 181 zu schnappen, um damit auf die Seite der Amerikaner abzuhauen. Um nicht als Gefangene erkannt zu werden, zogen sie die französischen Flugwarte-Uniformen an. Sie erreichten die Maschine auch und begannen damit, sie startklar zu machen. Nur der Motor musste noch angelassen werden. Es gab jedoch keinen elektrischen Anlasser, sodass der Motor mithilfe der Luftschraube von Hand angerissen werden musste. Der Fähnrich a.D. setzte sich also ins Cockpit, weil er ja mehr Flugerfahrung hatte. Der andere sollte die Schraube vier bis sechs Mal ohne Zündung durchdrehen. Das bewirkt, dass die Zylinder Kraftstoff ansaugen. Dann gab der Pilot das Zeichen, dass er jetzt die Zündung einschaltet und die Luftschraube nun noch einmal kräftig angerissen werden muss. Das ist keine leichte Arbeit, denn so ein Flugzeugmotor hat eine hohe Kompression, die erst einmal überwunden werden muss. Für Ungeübte ist dieser Vorgang eine lebensgefährliche Prozedur, denn sobald der Motor anspringt, dreht sich mit der gleichen Geschwindigkeit auch die Luftschraube.
So kam es, dass mein Kamerad seine linke Hand nicht schnell genug aus dem Rotationsbereich herausbekam, sodass sie ihm glatt abgeschlagen wurde. Trotzdem sprang er noch mit seiner stark blutenden Wunde in das Cockpit. Der Fähnrich a.D. war jedoch so sehr geschockt, dass er nicht die richtige Startposition erreichte. Mit Vollgas beschleunigte er die Maschine, bekam sie aber nicht mehr in die Luft. Am Rande des Flugplatzes waren verschiedene Flieger abgestellt, über die sie nicht hinwegkamen. Letztendlich krachten sie genau da hinein.
Sie wurden aus den Trümmern eingesammelt und ins Lazarett gebracht. Das alles muss so um den 25. Mai 1945 passiert sein.
(…)
Jetzt geht’s endlich los
Es war wohl so Ende August, als ich in das Sammellager in Brünn gebracht wurde. Noch immer stand ich etwas wackelig auf den Beinen, aber meine Wunden waren abgeheilt. Mehr konnte man für mich im Lazarett nicht tun. Mein Freund Alfred musste noch weiter dort bleiben. Als ich mich von ihm verabschiedete, sagte er sehr betrübt, dass die russische Ärztin ihm sämtliche Sterbelisten und die Soldbücher der toten Kameraden abgenommen hätte. Sie hätte ihm allerdings versprochen, dass sie dafür sorgen würde, dass er bei dem nächsten Transport nach Deutschland mit dabei ist. Ich habe Alfred Kaiser nie mehr wiedergesehen. Auch meine späteren Nachforschungen beim Roten Kreuz waren vergeblich.
Es war bereits Mitte September 1945 als wieder mal so eine Kommission kam. Das Lager war schon ziemlich leer. Wir waren in einer größeren Fabrikhalle untergebracht und schliefen auf blankem, teilweise aufgerissenem Holzboden. Darunter tummelten sich die Ratten. Wieder mal war ich einer von den Letzten der Allerletzten. Aber nun sollte es ja auch für mich nach Hause gehen. Wir mussten alle antreten und wurden gefragt, wer sich stark genug fühlt, einen Transport in die Heimat mitzumachen. Natürlich fühlte sich dazu jeder stark genug, selbst die Leute mit amputierten Gliedern. Mit falschem, freundlichem Grinsen nahmen die Kommissionsmitglieder unsere Bereitschaft zur Kenntnis.
Wenige Tage später, es muss der 20. September 1945 gewesen sein, kam der Befehl „Alles fertig machen zum Abmarsch“. Nun geht es endlich nach Hause, zunächst nach Deutschland, dann nach Breslau, Rotkehlchenweg 26, zu meinem Elternhaus. Ich wusste, dass die Gedanken und Gebete meiner Mutter täglich bei mir waren. Ich hätte sie so gern in den Arm genommen und ihr gesagt: „Mutter, hier bin ich, ich habe überlebt.“ Es sollte aber noch lange Zeit dauern, bis ich ihr das sagen konnte. Für die Kameraden, die schon Frau und Kinder hatten, war das alles noch viel schwerer zu ertragen. (…)